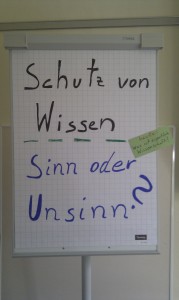Am Sonntag habe ich zur Frage geblogged, ob der Kaukasus-Leopard bei seiner geringen Verbreitung überhaupt noch eine Chance auf’s Überleben hat. Zu dieser Frage können nicht nur Biologen etwas beisteuern, sondern etwa auch Informatiker, indem sie das Ökosystem modellieren und simulieren und so Aufschluss darüber geben können, welche Maßnahme am dringendsten ist oder am meisten Erfolg verspricht. Oder Politologen und Soziologen, indem sie die Gesellschaftsstrukturen und -prozesse im Kaukasus untersuchen und mit entsprechenden Programmen die Menschen einbeziehen.
Warum sollten nicht auch Betriebswirte etwas dazu beitragen können? Warum sollten sie den WWF beispielsweise nicht darin unterstützen, Projekte zu begleiten, Kostenpläne zu erstellen, die Logistik für Kampagnen zu managen oder Marketingstrategien zu erarbeiten? Und so fänden sich sicher viele Probleme in der Praxis – außerhalb von Unternehmen – an deren Lösung auch Kaufleute mit ihrem Wissen mitwirken könnten.
Anfang des Jahres sprach der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt zu dem Thema und betonte die Verantwortung der Forschung im 21. Jahrhundert, die sich angesichts der Menschheitsprobleme ergäbe. Wissenschaft sei „eine zur sozialen Verantwortung verpflichtete Erkenntnissuche“ [1]. Etwas philosophischer betrachtet Martin Carrier die Frage nach den Werten in der Wissenschaft und kommt zu seinem persönlichen Schluss, dass abseits der methodischen Objektivität eine ethische Perspektive notwendig sei, in deren Folge sich Forscher auch mit den gesellschaftlichen Konsequenzen ihrer Arbeit auseinandersetzen sollten [2].
Es gibt in der Praxis so viele bedeutende (subjektiv, ich weiß) Probleme, zu deren Lösung auch Wirtschaftswissenschaftler beitragen können. Man muss nur mal eine Tageszeitung aufschlagen, um einen ersten Eindruck zu erhalten; danach bedarf es nur etwas Phantasie. Speziell für die Wirtschaftsinformatik diskutiert beispielsweise Urgestein Peter Mertens deren gesellschaftliche Rolle und führt auch Umweltschutz, Aus- und Weiterbildung oder Lebensstandards der Bevölkerung als relevante Bereiche des Fachs an [3]. Gary Hamel, in der Wirtschaftswelt kein ganz Unbekannter, ist der Ansicht, dass Betriebswirte sich mit Fragen wie „Warum sollten so viele Menschen in uninspirierenden Unternehmen arbeiten?“ oder „Warum sollten Manager ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht begrüßen statt ihr aus dem Wege zu gehen?“ zu beschäftigen haben [4]. Geld verdienen zu wollen, ist nichts Verwerfliches, aber man sollte die Umstände im Auge behalten. Und auch Forschung findet nicht in einem vom Umfeld isolierten System statt.
Was bedeutet das für mich und meine Arbeit? Ich selbst beschäftige mich in meiner Dissertation mit Lernen durch Lehren (LdL) in der betrieblichen Weiterbildung. Unternehmen könnten vom Einsatz des Konzepts profitieren (ob und wie, versuche ich einzugrenzen), aber besonders auch die Lernenden. Es geht bei LdL halt nicht nur darum, fachlich weiterzukommen, sondern sich über seinen Job hinaus auch selbst als Persönlichkeit zu entwickeln. Das verbuche ich unter einem gesellschaftlich bedeutsamen Aspekt. Der Gedanke der Weltverbesserung im Kleinen ist bei LdL im Prinzip fest eingebaut.
Wenn nun künftig Studierende von mir bei ihrer Abschlussarbeit betreut werden möchten, werden sie sich stets um solche Dinge Gedanken machen müssen. Ich werde auch solche Themen bevorzugt annehmen, die konkret einen klaren größeren Nutzen erkennen lassen – sei es die Personalführung in ehrenamtlicher Einrichtungen zu untersuchen oder Strategien für Non-Profit-Organisationen zu entwerfen.
Zum Weiterlesen
[1] Schmidt, Helmut (2011): Verantwortung der Forschung im 21. Jahrhundert, URL: http://www.mpg.de/990353/Verantwortung_der_Forschung (zuletzt abgerufen am 13.06.2011).
[2] Carrier, Martin (2011): Werte in der Wissenschaft, in: Spektrum der Wissenschaft, 34. Jg., Nr. 2, S. 66-70.
[3] Mertens, Peter (2011): Zur gesellschaftlichen Bedeutung der Wirtschaftsinformatik, in: Wirtschaftsinformatik & Management, 3. Jg., Nr. 1, S. 32-38.
[4] Hamel, Gary (2009): Moon Shots for Management, in: Harvard Business Review, 87. Jg., Nr. 2, S. 91-98.