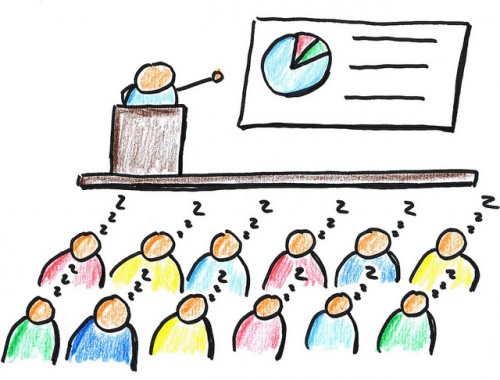Am Montag hatten wir Kristina „Luci“ Lucius und Christian Spannagel zu Gast in Braunschweig. Sie boten einen Workshop zum Thema Hörsaalspiele an, zu dem ich an anderer Stelle schon kurz berichtet habe. Geht ja wohl gar nicht!
Wo kommen wir denn bitteschön hin, wenn Spiele in eine der letzten Bastionen vordringen, die sich noch ernsthaft mit der Welt auseinandersetzt, wo kühle Ratio unverzichtbar ist? Spannung, Spiel und Schokolade mögen ja gut sein, um den Verkauf von nutzlosem Zeugs anzukurbeln. Sie haben aber nichts an einer seriösen Einrichtung zu suchen, an der gestandene WissenschaftlerInnen die Wahrheit suchen und vermitteln. Es steht zu viel auf dem Spiel!
Nur weil da einige infantile Kindsköpfe der Meinung sind, sie müssten ihre verqueren Ideen in Hörsäle bringen, um Studierende zu unterhalten, muss da noch lange nichts heißen. Lernen ist nun mal nüchtern und trocken und macht keinen Spaß. Alles andere ist doch pures Edutainment, um die Leute bei Laune zu halten. Was soll dabei rumkommen? Der Begriff „Studieren“ stammt immer noch von „studere“ ab, also „anstrengen“. Leichtes-Spiel-haben ist da nicht. Geht doch nach Nimmerland, wenn ihr nicht erwachsen werden wollt!
Wissenschaft, und damit auch die Lehre an Unis, ist ein hartes Geschäft. Es gibt in jedem Fach soooo viel wirklich, also wirklich unverzichtbaren Stoff, der in Hirne hineingeprügelt werden muss — da ist nun für Spaß wirklich keine Zeit. Medizin soll ja auch nicht schmecken, sondern helfen. Und früher ging das ja wohl auch ohne Spiele! Schon aus dem alten Rom stammt das bekannte Zitat: „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Carcassonne zerstört werden muss.“
 Und überhaupt! Wer sollte mich denn als Lehrenden auch noch ernst nehmen, wenn ich mich mit so etwas zum Affen mache? Das ist doch vollkommen unprofessionell! Was sollen denn andere Lehrende oder meine Chefs von mir denken? Oder die Studierenden? Die glauben mir doch nichts mehr, wenn ich sie spielen lasse. Und sie wollen auch gar nicht spielen! Das weiß ich ganz sicher.
Und überhaupt! Wer sollte mich denn als Lehrenden auch noch ernst nehmen, wenn ich mich mit so etwas zum Affen mache? Das ist doch vollkommen unprofessionell! Was sollen denn andere Lehrende oder meine Chefs von mir denken? Oder die Studierenden? Die glauben mir doch nichts mehr, wenn ich sie spielen lasse. Und sie wollen auch gar nicht spielen! Das weiß ich ganz sicher.
Ich stehe als Lehrender Modell, also muss ich mit gutem Beispiel vorangehen, auch wenn das heißt, mir einen Stock in den Allerwertesten schieben zu müssen. Und der Spannagel, also wie der als Professor rumrennt… Am Ende soll ich mir auch noch eine Clownnase aufsetzen, oder wie?
Spiele gehören in die Freizeit, nicht in den Hörsaal. Dafür ist die Uni nicht da, sondern für die kognitive Vermittlung des aktuellen Erkenntnisstands der Wissenschaft. Das lässt sich nicht mit Spielen erreichen. Schickimicki könnt ihr zu Hause machen!
Aus diesen Gründen wende ich mich mit dieser Fünf-Punkte-Minimalforderung an die Welt, um das Schlimmste vielleicht noch zu verhindern.
- Regelmäßige, unangekündigte Infantilitätstests für alle Angehörigen von Hochschulen, um sie gegebenenfalls aus der Institution auszuschließen
- Verbannung von Beispielen aus der Hochschullehre
- Verbot von grafischen Benutzeroberflächen an Hochschulrechnern, um die Lehrenden nicht per Point-and-Click für Computerspiele anzufixen
- Hochschulweiter Aushang von Parolen gegen Spiele auf Stammtischniveau — um den Bierernst zu fördern
- Einbau einer automatisch in regelmäßigen Abständen betätigten Spaßbremse in alle Hörsäle
Ich freue mich über weitere passende Forderungen in den Kommentaren!