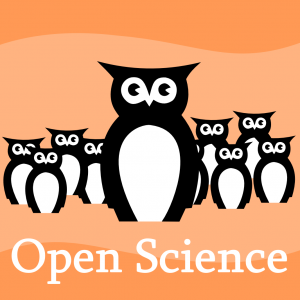Vor kurzem erschien die achte Ausgabe der Zeitschrift Goettingen Journal of International Law (GoJIL). Das wäre für sich genommen nicht der Rede wert, wenn es sich dabei nicht um eine englischsprachige, studentisch geführte Open-Access-Zeitschrift handelte, die obendrein schon jetzt einen guten Ruf genießt. Für mich war das ein Grund, die Chefredakteurin Annika Poschadel um ein Interview zu bitten.
Annika, fangen wir ganz vorne an: Wie kam es eigentlich zur Gründung von GoJIL?
GoJIL wurde 2007 von einer Gruppe an Völkerrecht interessierter Studenten gegründet, die sich die amerikanischen Law Journals zum Vorbild genommen haben. Diese Law Journals sind in den USA sehr populär. Für die Gründer war das ein Grund, dieses Format auch in Deutschland zu probieren. Damit ist ihnen der Start eines bislang in Europa einzigartigen Projekts gelungen, welches nun im dritten Jahr sehr erfolgreich läuft.
Das Ziel der Zeitschrift ist zum einen, einen hochwertigen Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte im Völkerrecht, aber in auch in anderen Fachbereichen mit Blick auf das internationale Recht zu leisten. Zum anderen wollen wir aber auch den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern. Durch unser anonymisiertes Gutachtenverfahren haben grundsätzlich auch Beiträge von Studierenden und bisher unbekannten Autoren Aussicht auf Erfolg. Daneben sprechen wir mit unserem jährlichen Schreibwettbewerb auch gezielt Studierende an. GoJIL fördert den Nachwuchs aber nicht nur auf der Output-, sondern auch auf der Inputseite, denn wir als Herausgeber lernen natürlich auch eine Menge dabei.
Du hast gerade erwähnt, GoJIL liefe erfolgreich. So erfolgreich, dass ihr im vergangenen Jahr eine internationale Konferenz abgehalten habt. Auch dort lag die Messlatte sehr hoch, ihr habt den Referenten sogar die Anreisekosten erstattet. So etwas zu organisieren, macht sicher sehr viel Arbeit, was motiviert euch dazu, so viel Freizeit zu opfern?
Die Motivation ist sicherlich das Ergebnis. Sowohl endlich eine Ausgabe zu “releasen” und den Autoren das fertige Exemplar schicken zu können, als auch in einem Buch plötzlich einen Verweis auf das eigene Werk zu sehen. Bezüglich der Konferenz war es wohl das Highlight plötzlich zu sehen, wie und dass alles funktioniert. Und ein Grund sind mit Sicherheit die Menschen: Nicht nur, dass man bei GoJIL einen Haufen Kommilitonen trifft, die genauso ticken wie man selbst, sondern man lernt auch international anerkannte Wissenschaftler kennen, die man bisher nur aus der Ferne bewundert hat.
Verändert das den Blick auf diese Wissenschaftler oder die Wissenschaft an sich?
Als Student hat man ja im Allgemeinen kaum Zugang zu „der Wissenschaft“, sodass durch die Arbeit bei GoJIL überhaupt erstmal ein Blick darauf möglich wird. Natürlich begegnet man den Wissenschaftlern mit Respekt für ihre Arbeit, aber durch den persönlichen Kontakt merkt man auch, dass es ganz normale Menschen sind, die Deadlines verschwitzen und Fehler machen. Gleichzeitig wird man als Herausgeber plötzlich Teil des Ganzen. Da nimmt man eine Zeitschrift in der Bibliothek plötzlich mit einem anderen Gefühl in die Hand.
Kommen wir wieder zurück zu GoJIL an sich. Warum habt ihr euch für Open Access entschieden? Ihr hättet schließlich auch eine klassische Zeitschrift daraus machen können.
Open Access passt zu unserer Philosophie, dass wir qualitativ hochwertige wissenschaftliche Publikationen einem breiten Publikum zur Verfügung stellen wollen. Insbesondere im Völkerrecht ist zudem eine internationale Verbreitung unerlässlich. Dies ist auch der Grund, weshalb wir auf ausschließlich auf Englisch publizieren. Es ist uns aber auch wichtig, dass unsere Artikel auch dort gelesen werden können, wo mangels finanzieller Mittel keine riesigen Bibliotheken möglich sind. Kürzlich dankte uns z. B. ein Wissenschaftler aus Bangladesh, dessen Uni sich keine kostenpflichtigen Journals leisten kann. Durch uns hat er trotzdem Zugriff zu wissenschaftlichen Beiträgen.
Nun gibt es unter dem Begriff „Open Access“ Bestrebungen, alle Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung der Öffentlichkeit auch unentgeltlich im Internet zugänglich zu machen, wobei der Autor allerdings alle weiteren Verwertungsrechte behielte und sein Werk auch anderswo veröffentlichen könnte. Es gibt Juristen, die darin einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit sehen. Das betrifft zwar GoJIL nicht, aber wie beurteilst du das?
Darüber habe ich mir bis eben gerade noch keine Gedanken gemacht.
Okay, nun wird Open Access desöfteren mangelnde Qualität vorgeworfen, man spricht mitunter abschätzig von universitären Selbstpublikationen. Wie sichert ihr die Qualität der Beiträge?
Die Qualitätssicherung ist uns sehr wichtig. Deshalb haben wir ein sog. Double-Blind-Peer Review-Verfahren. Das heißt, dass bei uns eingereichte Beiträge zunächst von zwei Wissenschaftlern, die ebenfalls in dem Feld des Beitrags forschen, begutachtet und bewertet werden. Das Verfahren läuft anonym ab, sodass es ausschließlich auf die Qualität und nicht auf den Namen oder Kontakte ankommt. Neben dieser inhaltlichen Kontrolle wird außerdem jeder Artikel von englischsprachigen Muttersprachlern korrigiert.
Und ihr prüft tatsächlich sogar die Angaben jeder einzelnen Fußnote, wenn ich richtig informiert bin!?
Ja, genau. Sofern uns die Quellen irgendwie zugänglich sind (was dank Internet und unserer gut ausgestatteten Uni-Bibliothek meistens der Fall ist), schlagen wir jede Fußnote nach. Das ist ziemlich aufwendig, aber die Qualität der Quellenangaben wird dadurch oft verbessert. Manchmal sind die Quellen in der angegebenen Form nur schwer auffindbar, das versuchen wir dann zu ändern. Zudem kommt es hin und wieder vor, dass Seitenangaben oder andere bibliografische Daten einfach nicht stimmen. All das bemerkt man aber eben nur, wenn man die zitierten Bücher persönlich in der Hand hatte. Außerdem lernen wir selbst dabei einiges über Recherchetechniken und Zitation. Man nimmt also auch einiges für seine eigenen Hausarbeiten mit und achtet deutlich besser auf seine Zitierweise.
Kommen wir zu einem weiteren kritischen Aspekt. Zwar wird immer wieder behauptet, „das Internet vergesse nichts“, aber so ganz stimmt das ja auch nicht. Wie sorgt ihr dafür, dass die Beiträge einfach und langfristig abgerufen werden können und nicht verloren gehen? Das ist unter dem Aspekt der Nachprüfbarkeit für die Wissenschaft ja ein wichtiger Punkt.
GoJIL ist in einer Mehrzahl der wichtigsten englischsprachigen juristischen Datenbanken verfügbar wie z. B. HeinOnline oder EBSCO. Damit sorgen wir dafür, dass wir auch dort auffindbar sind und unsere Artikel einer breiten Leserschaft zugänglich sind. Ansonsten sind alle Artikel auch auf unserer Homepage www.gojil.eu abrufbar. Als kleines Extra gibt es für die Papyrophilen auch Print-on-demand-Ausgaben bei Amazon zu kaufen. Dies stellt jedoch ausdrücklich nicht den Schwerpunkt unserer Tätigkeit dar. Im Selbstverständnis bleiben wir online und open access.
Zum Knackpunkt, das liebe Geld: Bei Open Access stellt sich stets die Frage der Finanzierung, es gibt verschiedene Modelle. Wie läuft das bei euch?
Wir werden vor allem über Spenden finanziert. Bei den Spendern möchten wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Das ist zum einen die Joachim-Herz-Stiftung aus Hamburg, die uns mit sehr viel Engagement fördert und der wir u. a. Unterstützung für die wunderbare Konferenz zu verdanken haben. Bei der Konferenz hat uns auch das KMU-Netzwerk aus Göttingen unterstützt, ebenso wie das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Zudem werden wir aus Studiengebühren finanziert. Unterstützung erhalten wir auch vom Göttinger Verein zur Förderung des internationalen Rechts. Das Institut für Völker- und Europarecht stellt uns ein Büro zur Verfügung und durch die Lehrstühle dort erhalten wir auch ideelle Unterstützung, dafür sind wir natürlich sehr dankbar.
Letzte Worte an die Leser?
Wir freuen uns immer über interessierte Leser und ebenso aufgeweckte Autoren. Beiträge dürfen immer gern über unsere Homepage www.gojil.eu eingereicht werden. Bei Kritik, Anregungen oder Fragen sind wir darüber ebenfalls zu erreichen.
Hinweise zu den Abbildungen
- Cover, Urheber: GoJIL, steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.
- Foto, Urheber: GoJIL, steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.